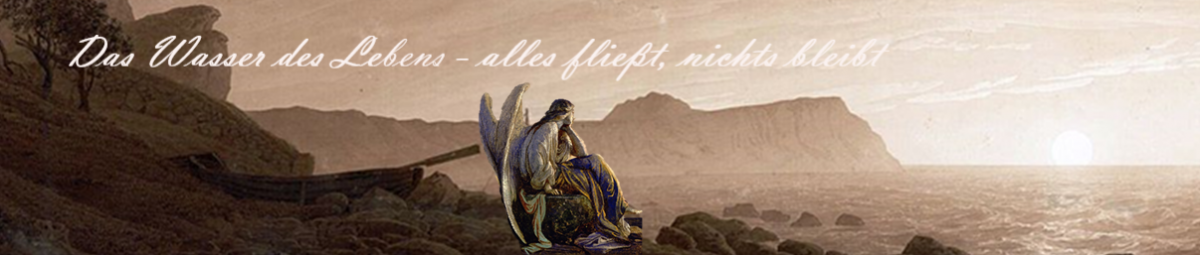Gekürzter Auszug aus meinem biografischen Roman über Henriette Brey (1875-1953)

1934
Heinrich sprach ein Tischgebet, so wie es früher Vater tat, und nachdem wir es mit einem „Amen“ beendet hatten, begann mein Bruder Josef zu erzählen: „Es ist bald so, wie vor zehn Jahren. Zu kaufen bekommt man fast überhaupt nichts mehr oder es ist so teuer, dass es niemand bezahlen kann. Das Geld ist nichts mehr wert und Arbeit gibt es auch kaum noch. Überall sagt man, mit Hitler würde bestimmt alles besser.“
Schon der Name bereitete mir Unbehagen. Diese Regierung hatte mir all meine Sicherheiten genommen. Bisher hatte ich meinen Lebensunterhalt durch meine schriftstellerischen Arbeiten bestreiten können. Ich fürchtete mich vor der Zukunft. Hitler ließ Bücher verbrennen, doch was kam als Nächstes?
Trotz alledem konnte ich meinen Bruder verstehen. Vor ein paar Jahren hatte er, wie alle anderen, noch stundenlang mit einer Brotkarte anstehen müssen, und wenn Maria es mal auf „Umwegen“ zu einem bisschen Gries oder Graupen und etwas Öl gebracht hatte, war die Freude groß und ein frisch ‚erbeutetes‘ Seifenstück war purer Luxus und kam direkt hinter dem Traum von Bohnenkaffee. Es war die Zeit, in der Tee noch selbst gesammelt wurde, um einen aufrührerischen Magen mit Brombeerblättertee zu beruhigen. Geraucht wurden Huflattichblätter und Buchenlaub, anstelle von Tabak. Wenn der Hunger allzu sehr drückte, band sich Josef einen Rucksack auf den Rücken und versuchte bei den umliegenden Bauern etwas Essbares einzuhamstern, was sich diese dann aber teuer bezahlen ließen.
Das war die bitterböse, schlimme Wirklichkeit, die alle erlebt hatten, und in der die schlanke Linie ganz von alleine kam. Das einzige Fett waren sechzig Gramm verwässerte Butter – die Ration für eine ganze Woche. Mutters Schweinebraten wurde zum unerreichbaren Ideal, dem man mit trüben Gedanken und ehrfürchtigem Schauer seufzend hinterher trauerte. Zigarren kosteten mit einem Mal Milliarden und man begann getrocknetes Kartoffelkraut in Tabak umzufunktionieren.

Wenn Maria mit viel Einfallsreichtum ein bisschen Zucker für den Kornkaffee auftreiben konnte, war Feiertag. Des Abends ging man früh ins Bett, um Brennholz zu sparen und konnte oft genug wegen des knurrenden Magens keinen Schlaf finden. War man endlich eingeschlafen, träumte man von einem herrlich gedeckten Kaffeetisch mit köstlichem Weizenbrot, goldgelber Butter, rosigem Schinken und Wurst, frisch aus dem Rauch. Ein Puderzucker überzogener Gugelhupf lockte zusammen mit echtem, duftenden Bohnenkaffee.
Schon wälzte man sich unruhig im Schlaf hin und her und erwachte mit einem leeren Gefühl in der Magengegend und mit vor Kälte zitternden Gliedern. Die Hosen schlotterten um die dürr gewordenen Beine. Vorbei der Traum von weißen, runden Würsten, dickem Schwartemagen, goldgelben Eidottern und Speck. Fort waren der prächtige Käselaib und das Paket mit wohlriechendem Tabak. Wie eine Fata Morgana zerrannen die geträumten Genüsse und zerplatzten in der Realität, wie bunte Seifenblasen.
Nun blickten wir stumm auf einen liebevoll gedeckten Tisch mit Schwarzbrot, Rosinenweißbrot und Rübenkraut. Maria hatte ein Stück Butter aufgetrieben und Heinrich war es gelungen, geräucherten Speck und ein wenig Kochwurst von einem benachbarten Bauern zu besorgen. Heute war Feiertag – extra für mich! Während meiner langen Krankenhauszeit hatte ich mich nicht um den alltäglichen Existenzkampf kümmern müssen, denn das Hospital, das von der Caritas geleitet wurde, erhielt genügend Lebensmittelrationen aus der umliegenden Landwirtschaft.
Anderen ging es nicht so gut. Die Zeitungen waren übervoll mit Firmenzusammenbrüchen und berichteten über die Massenarbeitslosigkeit. Sogar Banken wurden geschlossen. Die Welt stand wirtschaftlich am Abgrund. Bei sechs Millionen Arbeitslosen nahmen Kriminalität und Armut sprunghaft zu.
Die Bevölkerung hungerte, war verzweifelt und suchte nach Auswegen. Die schmalen Gesichter waren von Hoffnungslosigkeit gezeichnet. Ältere Menschen bekamen keine Arbeit mehr, und die jüngere Generation musste jede Arbeit annehmen, die sich ihr bot, um dem Hunger und der Obdachlosigkeit zu entgehen.
Oftmals war ein Freitod einziger Ausweg aus der existenziellen Not. Zum Überlebenskampf gehörten Heimarbeit, Hausieren und Tauschgeschäfte. In den Großstädten häuften sich die Unruhen und oft galt die Prostitution für viele Frauen, als letzter Ausweg um zu Überleben.

Hier auf dem Lande hatte jeder wenigstens ein kleines Stückchen Erde, das er bewirtschaften konnte. So schien das Überleben ein wenig leichter zu sein, weil man Gemüse und Kartoffeln selbst anbauen konnte. Obst war ebenfalls durch eigenen Anbau vorhanden, und Fleisch bekam Josef ab und zu durch Malerarbeiten von den Bauern im Umkreis. Doch auch hier wuchs die Armut, und die Tagelöhner, die vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, arbeiteten gewöhnlich zehn bis zwölf Stunden am Tag für einen Hungerlohn.
Zwischen den weiten Feldern des flachen Niederrheins hindurch, ziehen sich die alten römischen Heerstraßen, über die vor langer Zeit bereits die Legionen Cäsars stampften.
Manche der schnurgeraden Landstraßen sind jedoch erst unter Napoleons Herrschaft entstanden. Als darauf französische und belgische Truppen am 11. Januar 1923 in das Ruhrgebiet einmarschierten, leistete die Bevölkerung erbittert Widerstand gegen das teilweise brutale Vorgehen des Militärs. Unaufhaltsam setzten die fremden Mächte ihren Marsch mit schweren Schritten immer weiter auf deutscher Erde fort und besetzten den Niederrhein, um die Reparationsleistungen für den ersten Weltkrieg einzufordern. So wurde die deutsche Wirtschaft schließlich durch die Absperrung des Ruhrgebietes und wegen anhaltender Streiks und Produktionsausfälle ruiniert.
Die Bevölkerung zahlte ihren bitteren Zoll und musste die Gürtel noch enger schnallen. Nun hungerte auch die Landbevölkerung, denn sie hatte den Großteil ihrer erwirtschafteten Güter an die Besatzer abzugeben.
Wo man sich sonst mittags gegen vier Uhr mit allen Hausgenossen bei Tisch zusammenfand, um reichlich Kaffee mit Butterbrot zu sich zu nehmen, stand man vor leeren Vorratskammern. Es gab an Stelle von Brot nur Mehlsuppe und ab und zu schlecht schmeckenden Kaffee-Ersatz.
Als bitterer Nachgeschmack verblieb ein gesteigerter Franzosenhass in den Köpfen der Einheimischen, und eine allgemeine Fremdenfeindlichkeit brannte sich tief in die leidgeprüften Gemüter ein, die Hunger und Not nicht vergessen konnten. So folgte man willig den neuen Parolen, die bessere Zeiten und Arbeit versprachen, und die Mühlen des Hasses drehten sich schneller und schneller.